














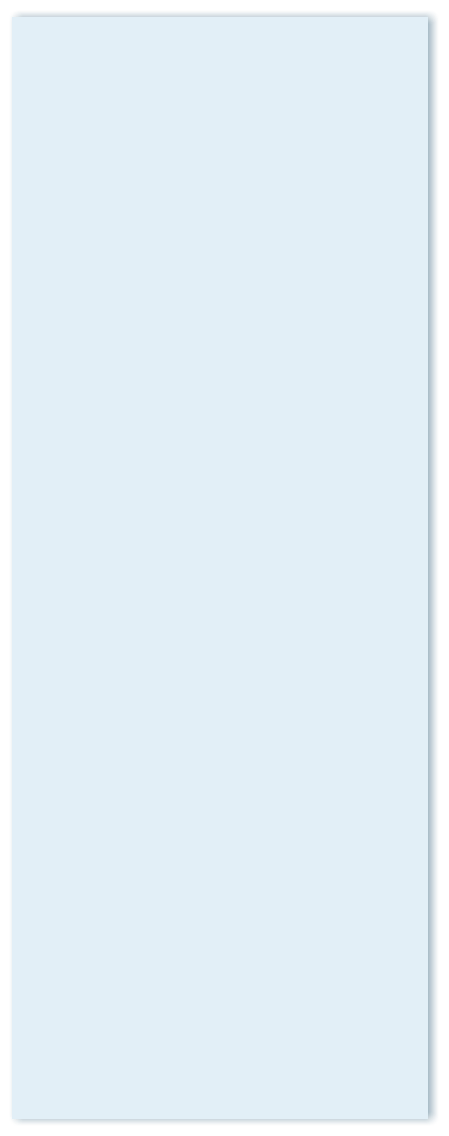

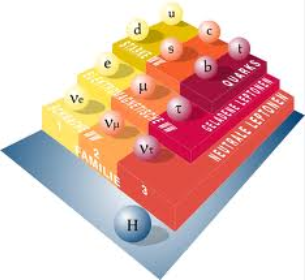 Nach unserem heutigen Verständnis ist die Welt aus den beiden
Elementarteilchensorten Quarks und den Leptonen aufgebaut.
”Elementar” bedeutet dabei, dass sie nicht aus anderen, noch kleineren
Teilchen zusammengesetzt sind und somit unsere fundamentalen,
kleinsten Bausteine der Natur darstellen. Diese können durch den
Austausch sogenannter Bosonen miteinander wechselwirken, also
anziehende oder abstoßende Kräfte aufeinander ausüben und
gebunden Zustände bilden. Die vier fundamentalen Kräfte werden
durch den Austausch unterschiedlicher Bosonen vermittelt: Die
elektromagnetische Kraft (Licht der Sonne, Regenbogen, Batterien,
rote und blaue Magnetpole der Lego-Eisenbahn etc.) wird durch den
Austausch von Photonen oder Gamma-Quanten vermittelt. Der
Austausch von Gluonen (engl. glue = Klebstoff) ergibt die starke Kraft,
die in größeren Atomkernen auf winzigen Abständen Protonen und
Neutronen zusammenhält, obwohl die Protonen gleiche positive
elektrische Ladung tragen und sich somit mit enormer Kraft abstoßen
müssten. Der Austausch von W+, W- oder Z0 Bosonen vermittelt die
schwache Kraft, die unter anderem für den radioaktiven Zerfall oder
das Brennen der Sonne verantwortlich ist. Die Gravitation ist
quantenmechanisch noch nicht verstanden. Sie wird vermutlich durch
den Austausch von Gravitonen vermittelt.
Die Quarks nehmen an allen drei bekannten fundamentalen
Wechselwirkungen teil, während die Leptonen nur der
elektromagnetischen und der schwachen Kraft unterliegen. Aus Quarks
sind Protonen und Neutronen aufgebaut, aus denen wiederum
Atomkerne bestehen. Das Elektron wurde 1897 entdeckt und ist heute
das bekannteste Lepton. Aus einem oder mehreren Elektronen besteht
die Hüllen von Atomen. Wenn Elektronen sich bewegen, entsteht ein
elektrischer Strom, z.B. in Form eines Blitzes bei einem Gewitter
deutlich sichtbar. Reiben wir einen Luftballon an einem Wollpullover,
lösen wir aus dessen Atomen Elektronen aus, so dass er
elektrostatisch aufgeladen wird. Elektronen und elektrische Ströme sind
allgegenwärtig und beherrschen inzwischen unseren Alltag. Zum
elektrisch geladenen Elektron gehört als Lepton-Partner das elektrisch
neutrale Elektron-Neutrino, dessen Masse winzig klein ist.
Quarks und Leptonen kommen in verschiedenen Variationen vor, die
sich scheinbar nur in ihrer Masse unterscheiden und sonst gleiche
Eigenschaften haben. Diese Variationen werden auch Familien oder
Generationen genannt. Das Elektron gehört zur ersten, leichtesten
Generation. Das Myon (μ) ist das geladene Lepton der zweiten
Generation und besitzt sein eigenes Partner-Lepton, das Myon-
Neutrino. Das Lepton der dritten Generation ist das Tau-Lepton mit dem
zugehörigen Tau-Neutrino. Das Myon ist etwa 200-mal schwerer als ein
Elektron. Als Konsequenz daraus zerfällt es im Schnitt in etwa 2.2
Mikrosekunden in ein Elektron und zwei Neutrinos zerfällt, ist also sehr
schwer zu untersuchen. Sehr schnelle, hoch-relativistische Myonen
können hingegen leichter untersucht werden, da deren Lebensdauer im
ruhenden Laborsystem um den Faktor βɣ mit β=v/c und ɣ=1/sqrt(1-β2)
verlängert scheint (Zeitdilatation). Über den Zusammenhang der
speziellen Relativitätstheorie hat Albert Einstein das Myon-Paradoxon
erklärt, also die Frage weshalb Myonen, die in etwa 13 km über den
Erdboden entstehen und selbst bei Lichtgeschwindigkeit nur etwa 660
m fliegen sollten, überhaupt und in großer Anzahl den Erdboden
erreichen. Einige Eigenschaften der Myonen sind im Folgenden
zusammengefasst. Weitere Informationen können in einer
Zusammenfassung der Particle Data Group nachgelesen werden.
Myon Masse
m = 105.7 MeV, also ~ 200-mal Elektronenmasse
Lebensdauer
τ = 2.2 10−6 s
1936 von Carl D. Andersen und Seth Neddermayer in der
Untersuchung kosmischer Strahlung mit einer Nebelkammer entdeckt.
Myonen entstehen unter anderem im Zerfall von Pionen, die ihrerseits
in großer Anzahl entstehen, wenn Protonen auf Materie auftreffen und
dabei zerbrechen.
Nach unserem heutigen Verständnis ist die Welt aus den beiden
Elementarteilchensorten Quarks und den Leptonen aufgebaut.
”Elementar” bedeutet dabei, dass sie nicht aus anderen, noch kleineren
Teilchen zusammengesetzt sind und somit unsere fundamentalen,
kleinsten Bausteine der Natur darstellen. Diese können durch den
Austausch sogenannter Bosonen miteinander wechselwirken, also
anziehende oder abstoßende Kräfte aufeinander ausüben und
gebunden Zustände bilden. Die vier fundamentalen Kräfte werden
durch den Austausch unterschiedlicher Bosonen vermittelt: Die
elektromagnetische Kraft (Licht der Sonne, Regenbogen, Batterien,
rote und blaue Magnetpole der Lego-Eisenbahn etc.) wird durch den
Austausch von Photonen oder Gamma-Quanten vermittelt. Der
Austausch von Gluonen (engl. glue = Klebstoff) ergibt die starke Kraft,
die in größeren Atomkernen auf winzigen Abständen Protonen und
Neutronen zusammenhält, obwohl die Protonen gleiche positive
elektrische Ladung tragen und sich somit mit enormer Kraft abstoßen
müssten. Der Austausch von W+, W- oder Z0 Bosonen vermittelt die
schwache Kraft, die unter anderem für den radioaktiven Zerfall oder
das Brennen der Sonne verantwortlich ist. Die Gravitation ist
quantenmechanisch noch nicht verstanden. Sie wird vermutlich durch
den Austausch von Gravitonen vermittelt.
Die Quarks nehmen an allen drei bekannten fundamentalen
Wechselwirkungen teil, während die Leptonen nur der
elektromagnetischen und der schwachen Kraft unterliegen. Aus Quarks
sind Protonen und Neutronen aufgebaut, aus denen wiederum
Atomkerne bestehen. Das Elektron wurde 1897 entdeckt und ist heute
das bekannteste Lepton. Aus einem oder mehreren Elektronen besteht
die Hüllen von Atomen. Wenn Elektronen sich bewegen, entsteht ein
elektrischer Strom, z.B. in Form eines Blitzes bei einem Gewitter
deutlich sichtbar. Reiben wir einen Luftballon an einem Wollpullover,
lösen wir aus dessen Atomen Elektronen aus, so dass er
elektrostatisch aufgeladen wird. Elektronen und elektrische Ströme sind
allgegenwärtig und beherrschen inzwischen unseren Alltag. Zum
elektrisch geladenen Elektron gehört als Lepton-Partner das elektrisch
neutrale Elektron-Neutrino, dessen Masse winzig klein ist.
Quarks und Leptonen kommen in verschiedenen Variationen vor, die
sich scheinbar nur in ihrer Masse unterscheiden und sonst gleiche
Eigenschaften haben. Diese Variationen werden auch Familien oder
Generationen genannt. Das Elektron gehört zur ersten, leichtesten
Generation. Das Myon (μ) ist das geladene Lepton der zweiten
Generation und besitzt sein eigenes Partner-Lepton, das Myon-
Neutrino. Das Lepton der dritten Generation ist das Tau-Lepton mit dem
zugehörigen Tau-Neutrino. Das Myon ist etwa 200-mal schwerer als ein
Elektron. Als Konsequenz daraus zerfällt es im Schnitt in etwa 2.2
Mikrosekunden in ein Elektron und zwei Neutrinos zerfällt, ist also sehr
schwer zu untersuchen. Sehr schnelle, hoch-relativistische Myonen
können hingegen leichter untersucht werden, da deren Lebensdauer im
ruhenden Laborsystem um den Faktor βɣ mit β=v/c und ɣ=1/sqrt(1-β2)
verlängert scheint (Zeitdilatation). Über den Zusammenhang der
speziellen Relativitätstheorie hat Albert Einstein das Myon-Paradoxon
erklärt, also die Frage weshalb Myonen, die in etwa 13 km über den
Erdboden entstehen und selbst bei Lichtgeschwindigkeit nur etwa 660
m fliegen sollten, überhaupt und in großer Anzahl den Erdboden
erreichen. Einige Eigenschaften der Myonen sind im Folgenden
zusammengefasst. Weitere Informationen können in einer
Zusammenfassung der Particle Data Group nachgelesen werden.
Myon Masse
m = 105.7 MeV, also ~ 200-mal Elektronenmasse
Lebensdauer
τ = 2.2 10−6 s
1936 von Carl D. Andersen und Seth Neddermayer in der
Untersuchung kosmischer Strahlung mit einer Nebelkammer entdeckt.
Myonen entstehen unter anderem im Zerfall von Pionen, die ihrerseits
in großer Anzahl entstehen, wenn Protonen auf Materie auftreffen und
dabei zerbrechen.
 Myonen
Myonen




















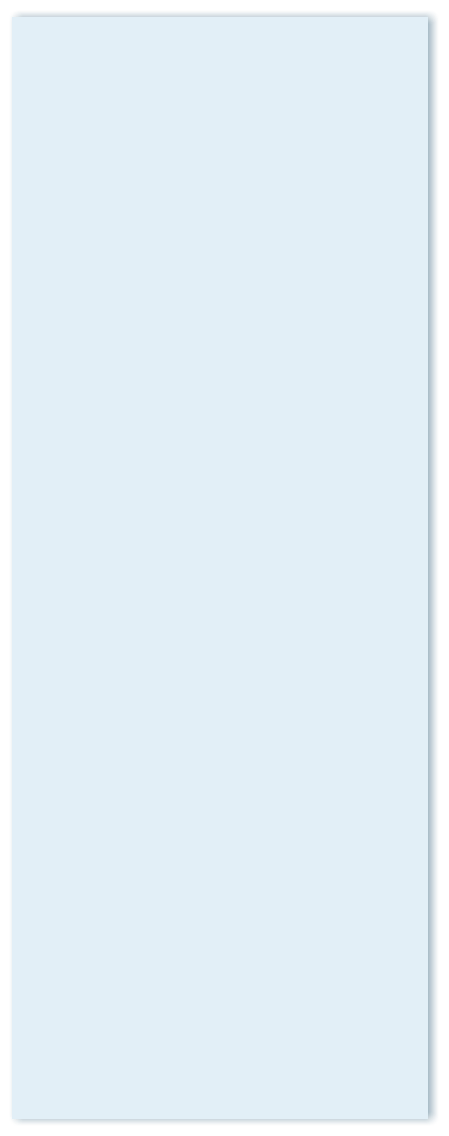

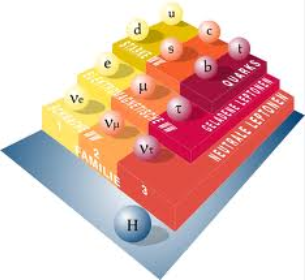 Nach unserem heutigen Verständnis ist die Welt aus den beiden
Elementarteilchensorten Quarks und den Leptonen aufgebaut.
”Elementar” bedeutet dabei, dass sie nicht aus anderen, noch kleineren
Teilchen zusammengesetzt sind und somit unsere fundamentalen,
kleinsten Bausteine der Natur darstellen. Diese können durch den
Austausch sogenannter Bosonen miteinander wechselwirken, also
anziehende oder abstoßende Kräfte aufeinander ausüben und
gebunden Zustände bilden. Die vier fundamentalen Kräfte werden
durch den Austausch unterschiedlicher Bosonen vermittelt: Die
elektromagnetische Kraft (Licht der Sonne, Regenbogen, Batterien,
rote und blaue Magnetpole der Lego-Eisenbahn etc.) wird durch den
Austausch von Photonen oder Gamma-Quanten vermittelt. Der
Austausch von Gluonen (engl. glue = Klebstoff) ergibt die starke Kraft,
die in größeren Atomkernen auf winzigen Abständen Protonen und
Neutronen zusammenhält, obwohl die Protonen gleiche positive
elektrische Ladung tragen und sich somit mit enormer Kraft abstoßen
müssten. Der Austausch von W+, W- oder Z0 Bosonen vermittelt die
schwache Kraft, die unter anderem für den radioaktiven Zerfall oder
das Brennen der Sonne verantwortlich ist. Die Gravitation ist
quantenmechanisch noch nicht verstanden. Sie wird vermutlich durch
den Austausch von Gravitonen vermittelt.
Die Quarks nehmen an allen drei bekannten fundamentalen
Wechselwirkungen teil, während die Leptonen nur der
elektromagnetischen und der schwachen Kraft unterliegen. Aus Quarks
sind Protonen und Neutronen aufgebaut, aus denen wiederum
Atomkerne bestehen. Das Elektron wurde 1897 entdeckt und ist heute
das bekannteste Lepton. Aus einem oder mehreren Elektronen besteht
die Hüllen von Atomen. Wenn Elektronen sich bewegen, entsteht ein
elektrischer Strom, z.B. in Form eines Blitzes bei einem Gewitter
deutlich sichtbar. Reiben wir einen Luftballon an einem Wollpullover,
lösen wir aus dessen Atomen Elektronen aus, so dass er
elektrostatisch aufgeladen wird. Elektronen und elektrische Ströme sind
allgegenwärtig und beherrschen inzwischen unseren Alltag. Zum
elektrisch geladenen Elektron gehört als Lepton-Partner das elektrisch
neutrale Elektron-Neutrino, dessen Masse winzig klein ist.
Quarks und Leptonen kommen in verschiedenen Variationen vor, die
sich scheinbar nur in ihrer Masse unterscheiden und sonst gleiche
Eigenschaften haben. Diese Variationen werden auch Familien oder
Generationen genannt. Das Elektron gehört zur ersten, leichtesten
Generation. Das Myon (μ) ist das geladene Lepton der zweiten
Generation und besitzt sein eigenes Partner-Lepton, das Myon-
Neutrino. Das Lepton der dritten Generation ist das Tau-Lepton mit dem
zugehörigen Tau-Neutrino. Das Myon ist etwa 200-mal schwerer als ein
Elektron. Als Konsequenz daraus zerfällt es im Schnitt in etwa 2.2
Mikrosekunden in ein Elektron und zwei Neutrinos zerfällt, ist also sehr
schwer zu untersuchen. Sehr schnelle, hoch-relativistische Myonen
können hingegen leichter untersucht werden, da deren Lebensdauer im
ruhenden Laborsystem um den Faktor βɣ mit β=v/c und ɣ=1/sqrt(1-β2)
verlängert scheint (Zeitdilatation). Über den Zusammenhang der
speziellen Relativitätstheorie hat Albert Einstein das Myon-Paradoxon
erklärt, also die Frage weshalb Myonen, die in etwa 13 km über den
Erdboden entstehen und selbst bei Lichtgeschwindigkeit nur etwa 660
m fliegen sollten, überhaupt und in großer Anzahl den Erdboden
erreichen. Einige Eigenschaften der Myonen sind im Folgenden
zusammengefasst. Weitere Informationen können in einer
Zusammenfassung der Particle Data Group nachgelesen werden.
Myon Masse
m = 105.7 MeV, also ~ 200-mal Elektronenmasse
Lebensdauer
τ = 2.2 10−6 s
1936 von Carl D. Andersen und Seth Neddermayer in der
Untersuchung kosmischer Strahlung mit einer Nebelkammer entdeckt.
Myonen entstehen unter anderem im Zerfall von Pionen, die ihrerseits
in großer Anzahl entstehen, wenn Protonen auf Materie auftreffen und
dabei zerbrechen.
Nach unserem heutigen Verständnis ist die Welt aus den beiden
Elementarteilchensorten Quarks und den Leptonen aufgebaut.
”Elementar” bedeutet dabei, dass sie nicht aus anderen, noch kleineren
Teilchen zusammengesetzt sind und somit unsere fundamentalen,
kleinsten Bausteine der Natur darstellen. Diese können durch den
Austausch sogenannter Bosonen miteinander wechselwirken, also
anziehende oder abstoßende Kräfte aufeinander ausüben und
gebunden Zustände bilden. Die vier fundamentalen Kräfte werden
durch den Austausch unterschiedlicher Bosonen vermittelt: Die
elektromagnetische Kraft (Licht der Sonne, Regenbogen, Batterien,
rote und blaue Magnetpole der Lego-Eisenbahn etc.) wird durch den
Austausch von Photonen oder Gamma-Quanten vermittelt. Der
Austausch von Gluonen (engl. glue = Klebstoff) ergibt die starke Kraft,
die in größeren Atomkernen auf winzigen Abständen Protonen und
Neutronen zusammenhält, obwohl die Protonen gleiche positive
elektrische Ladung tragen und sich somit mit enormer Kraft abstoßen
müssten. Der Austausch von W+, W- oder Z0 Bosonen vermittelt die
schwache Kraft, die unter anderem für den radioaktiven Zerfall oder
das Brennen der Sonne verantwortlich ist. Die Gravitation ist
quantenmechanisch noch nicht verstanden. Sie wird vermutlich durch
den Austausch von Gravitonen vermittelt.
Die Quarks nehmen an allen drei bekannten fundamentalen
Wechselwirkungen teil, während die Leptonen nur der
elektromagnetischen und der schwachen Kraft unterliegen. Aus Quarks
sind Protonen und Neutronen aufgebaut, aus denen wiederum
Atomkerne bestehen. Das Elektron wurde 1897 entdeckt und ist heute
das bekannteste Lepton. Aus einem oder mehreren Elektronen besteht
die Hüllen von Atomen. Wenn Elektronen sich bewegen, entsteht ein
elektrischer Strom, z.B. in Form eines Blitzes bei einem Gewitter
deutlich sichtbar. Reiben wir einen Luftballon an einem Wollpullover,
lösen wir aus dessen Atomen Elektronen aus, so dass er
elektrostatisch aufgeladen wird. Elektronen und elektrische Ströme sind
allgegenwärtig und beherrschen inzwischen unseren Alltag. Zum
elektrisch geladenen Elektron gehört als Lepton-Partner das elektrisch
neutrale Elektron-Neutrino, dessen Masse winzig klein ist.
Quarks und Leptonen kommen in verschiedenen Variationen vor, die
sich scheinbar nur in ihrer Masse unterscheiden und sonst gleiche
Eigenschaften haben. Diese Variationen werden auch Familien oder
Generationen genannt. Das Elektron gehört zur ersten, leichtesten
Generation. Das Myon (μ) ist das geladene Lepton der zweiten
Generation und besitzt sein eigenes Partner-Lepton, das Myon-
Neutrino. Das Lepton der dritten Generation ist das Tau-Lepton mit dem
zugehörigen Tau-Neutrino. Das Myon ist etwa 200-mal schwerer als ein
Elektron. Als Konsequenz daraus zerfällt es im Schnitt in etwa 2.2
Mikrosekunden in ein Elektron und zwei Neutrinos zerfällt, ist also sehr
schwer zu untersuchen. Sehr schnelle, hoch-relativistische Myonen
können hingegen leichter untersucht werden, da deren Lebensdauer im
ruhenden Laborsystem um den Faktor βɣ mit β=v/c und ɣ=1/sqrt(1-β2)
verlängert scheint (Zeitdilatation). Über den Zusammenhang der
speziellen Relativitätstheorie hat Albert Einstein das Myon-Paradoxon
erklärt, also die Frage weshalb Myonen, die in etwa 13 km über den
Erdboden entstehen und selbst bei Lichtgeschwindigkeit nur etwa 660
m fliegen sollten, überhaupt und in großer Anzahl den Erdboden
erreichen. Einige Eigenschaften der Myonen sind im Folgenden
zusammengefasst. Weitere Informationen können in einer
Zusammenfassung der Particle Data Group nachgelesen werden.
Myon Masse
m = 105.7 MeV, also ~ 200-mal Elektronenmasse
Lebensdauer
τ = 2.2 10−6 s
1936 von Carl D. Andersen und Seth Neddermayer in der
Untersuchung kosmischer Strahlung mit einer Nebelkammer entdeckt.
Myonen entstehen unter anderem im Zerfall von Pionen, die ihrerseits
in großer Anzahl entstehen, wenn Protonen auf Materie auftreffen und
dabei zerbrechen.
 Myonen
Myonen










